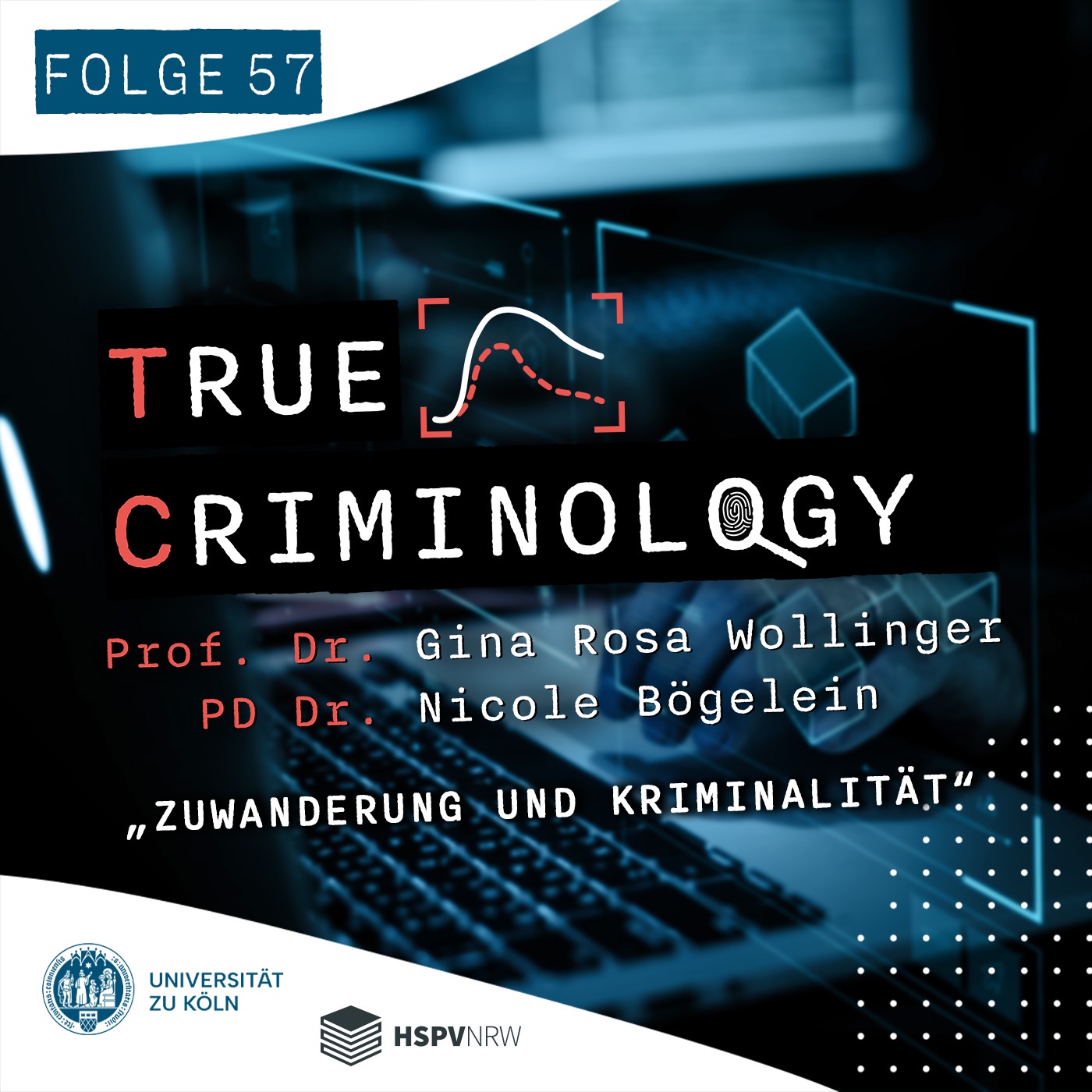
Alle Episoden
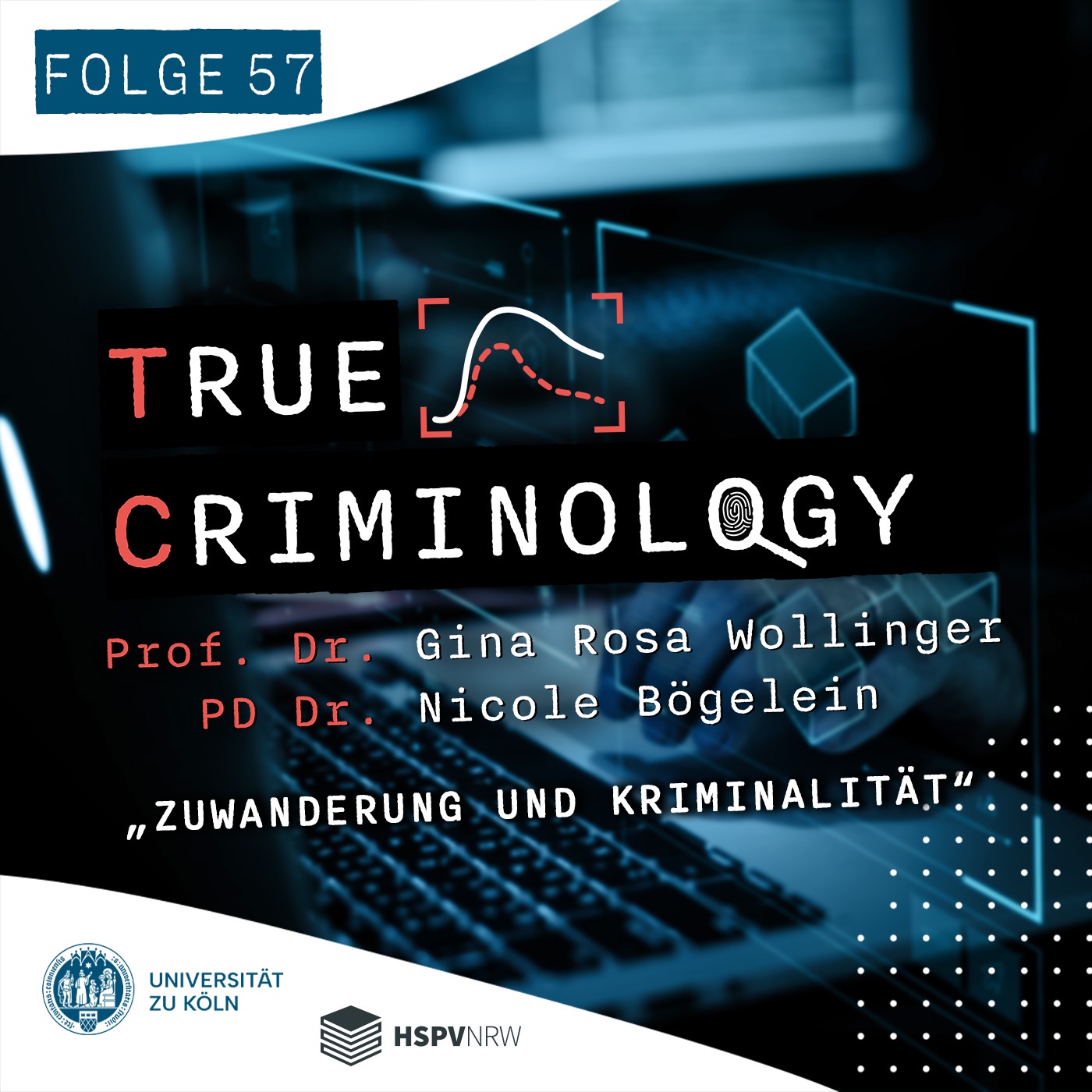
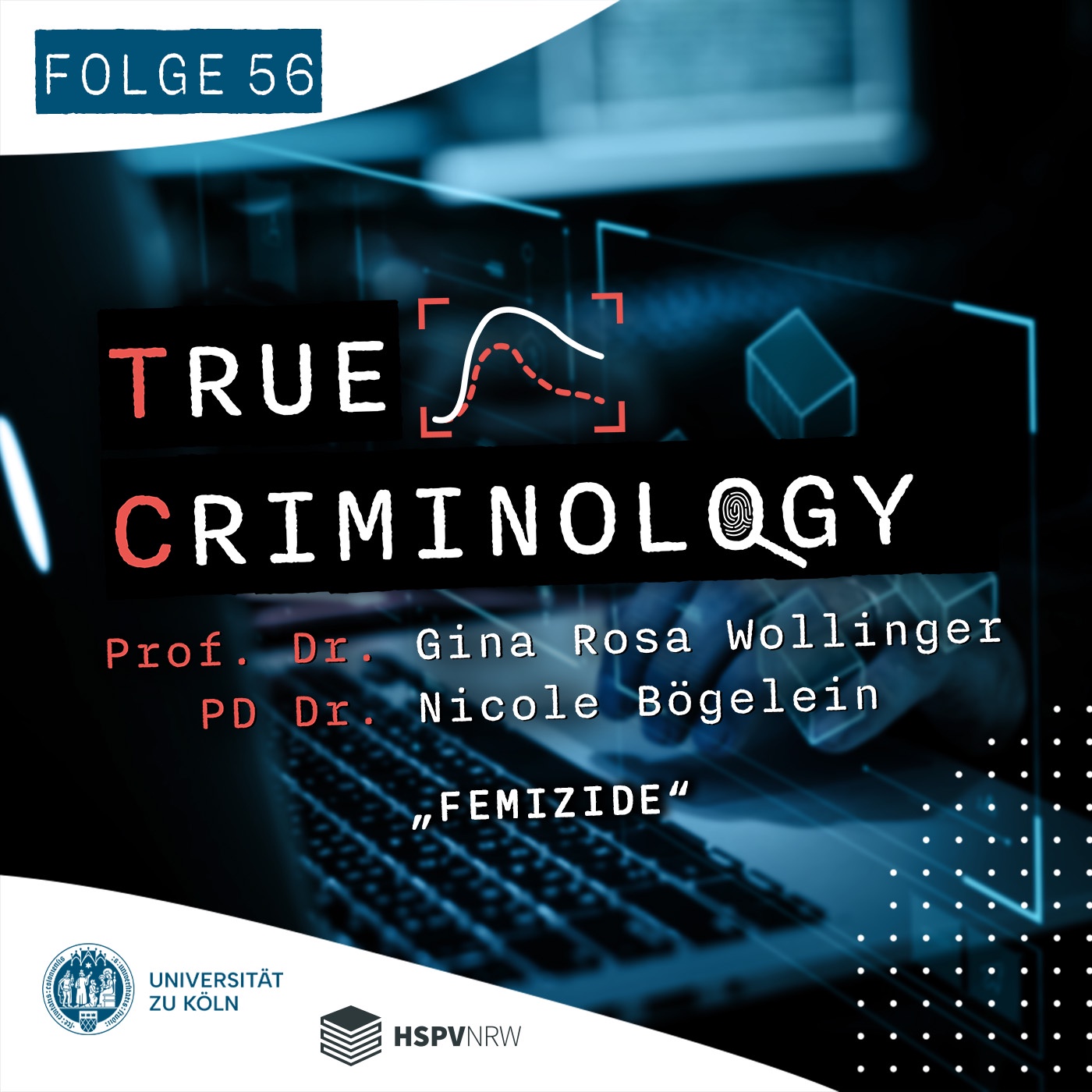
Femizide
Mit Femiziden ist die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts gemeint. Damit sind unter anderem gemeint Intimpartnerinnentötungen oder Tötungen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Was weiterhin darunter fällt und was eine Studie in Deutschland zum Thema ergeben hat, besprechen wir in dieser Folge.
Quellen / zur Vertiefung:
Rebmann, F.; Maier, S.P.; Stelly, W.; Thomas, J.; Lutz, P.; Labarta Greven, N. (2025): Femizide in Deutschland. Eine empirisch-kriminologische Untersuchung zur Tötung an Frauen.
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/172346
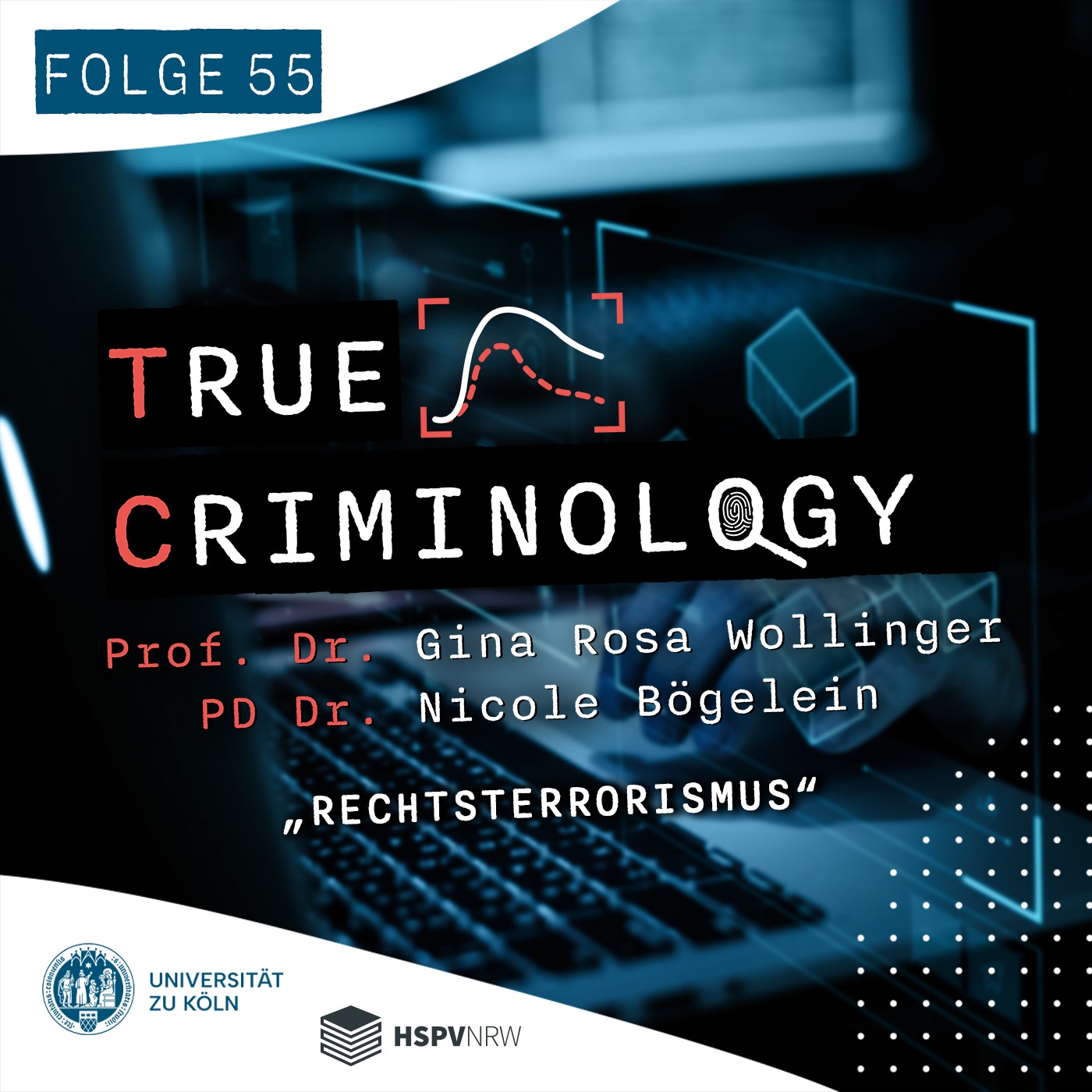
Rechtsterrorismus
Lange Zeit, wurde Terrorismus in Deutschland nicht im Zusammenhang mit Rechtsextremismus gesehen.
Das liegt vor allem am Verständnis von Terrorismus und Besonderheiten von rechtsextremen Taten. Rechte Gewalt als Phänomen von Einzeltäter:innen zu sehen, wird der Relevanz und Komplexität der Taten jedoch nicht gerecht.
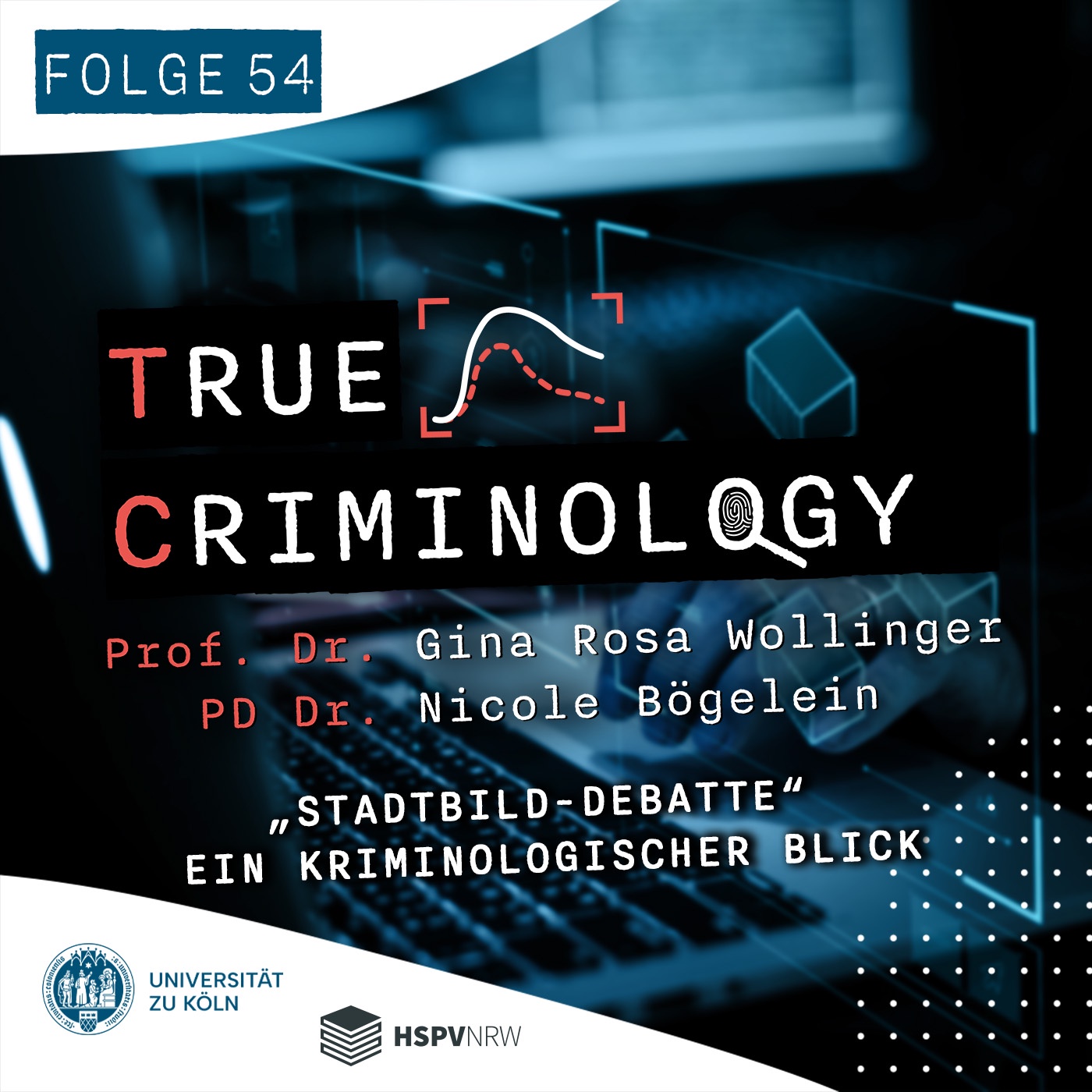
„Stadtbild-Debatte“ – Ein kriminologischer Blick
Bundeskanzler Merz hat mit seiner Aussage zum „Stadtbild“ eine breite
Debatte ausgelöst. Dabei geht es um Migration und Kriminalität,
Sicherheitsgefühle und die Bedrohung von Frauen. Wir ordnen das Ganze aus
kriminologischer Perspektive ein.
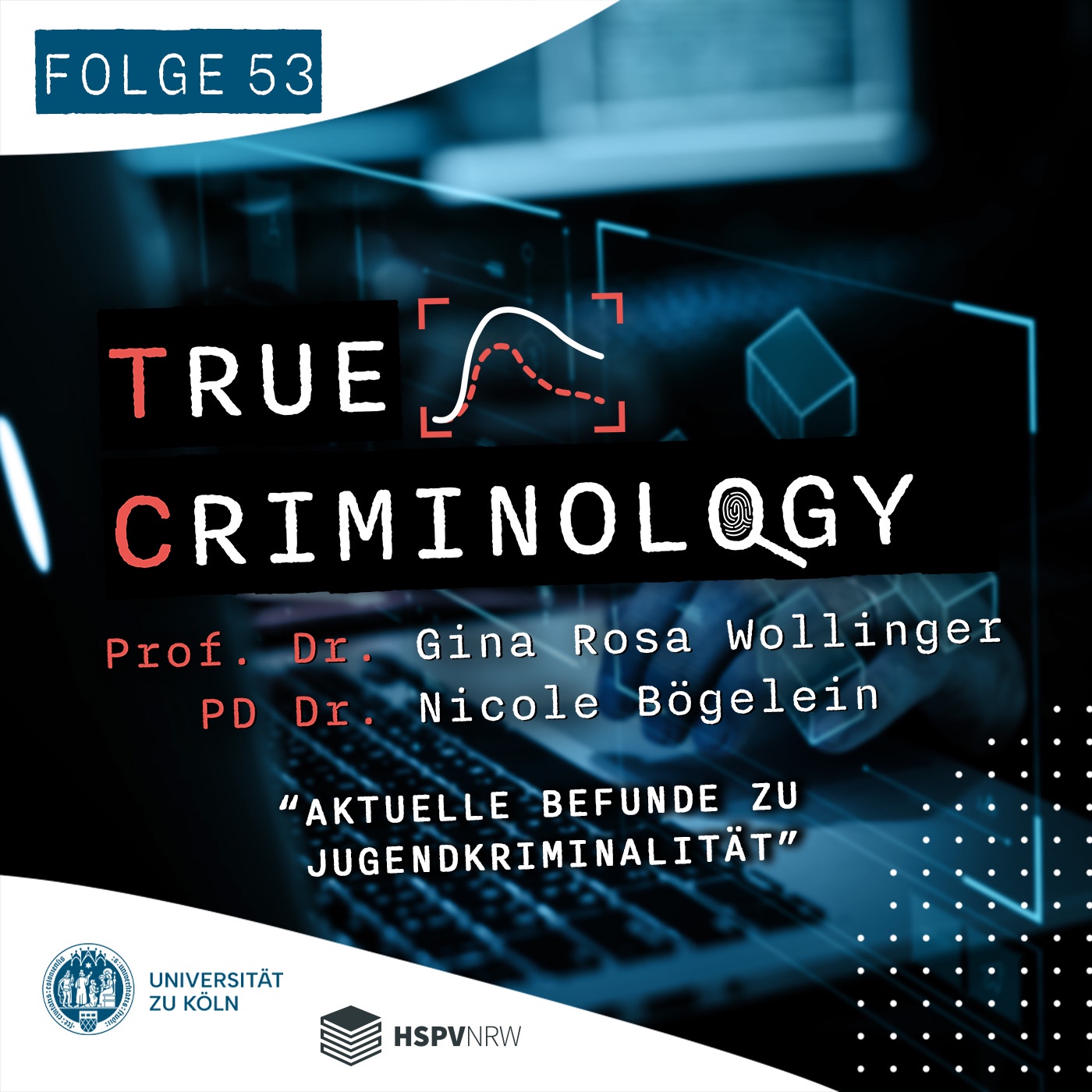
Aktuelle Befunde zu Jugendkriminalität
Wird alles mit der Jugend immer schlimmer?
In dieser Folge stellen wir die Ergebnisse von zwei aktuellen Studien zu Jugendkriminalität vor.
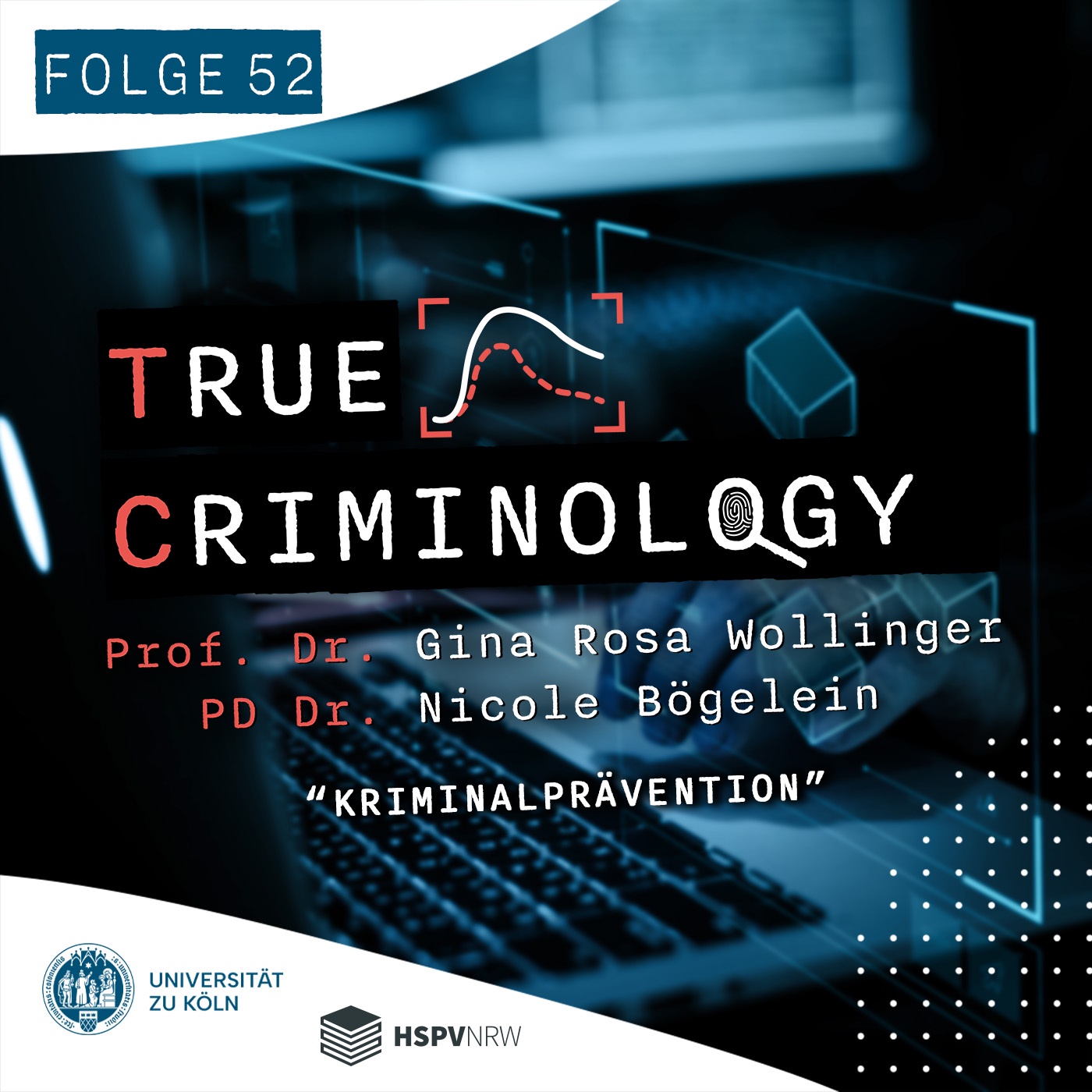
Kriminalprävention
Kriminalität verursacht Leid und vielfältigen Schäden. Da wäre es doch
gut dafür zu sorgen, dass Kriminalität gar nicht erst passiert. In
dieser Folge gehen wir der Frage nach, in welcher Art und Weise
Prävention von Kriminalität versucht und gelingen kann.
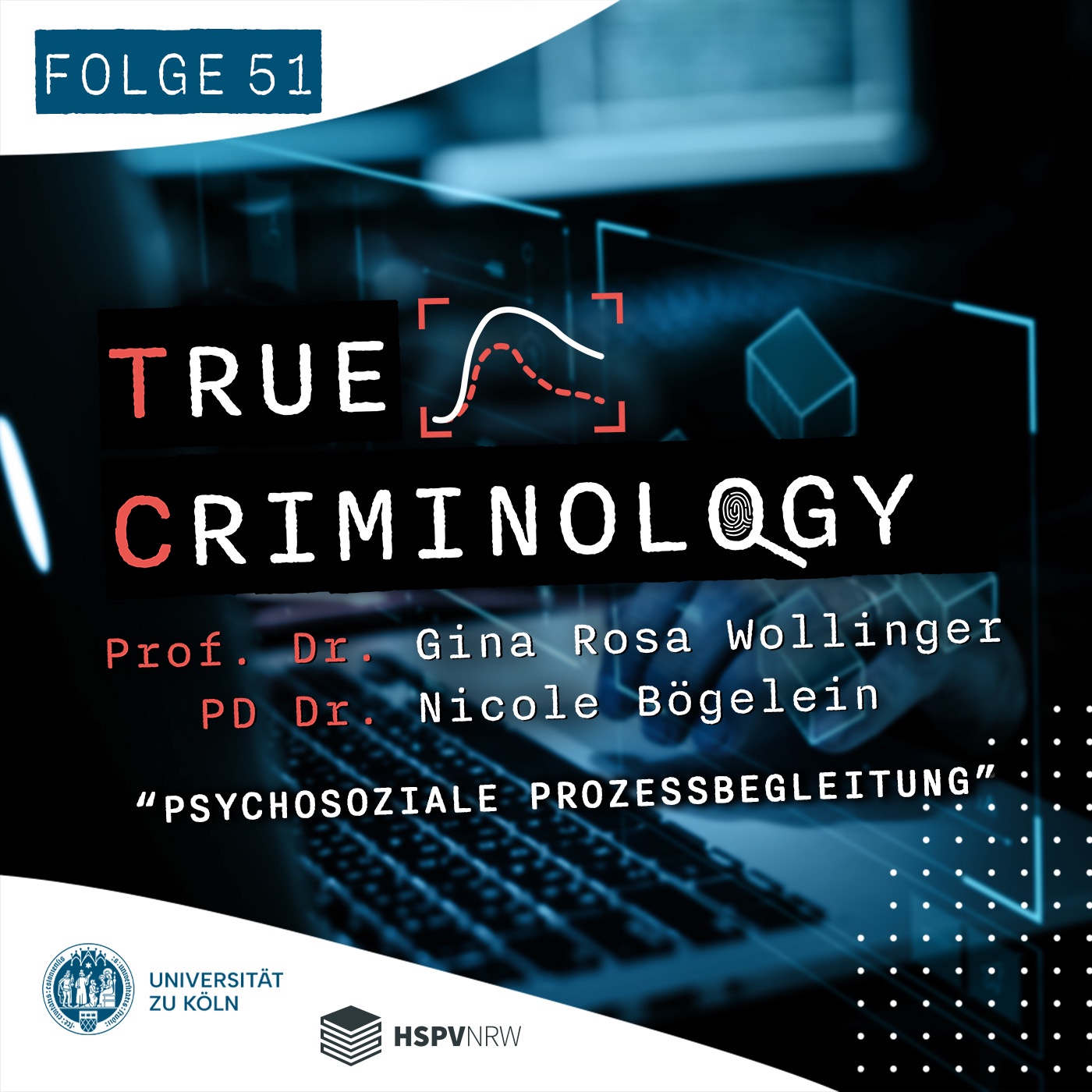
Psychosoziale Prozessbegleitung
Wenn der Weg zur Polizei und durch ein Strafverfahren für Betroffene emotional sehr belastend ist, gibt es Hilfe: die psychosoziale Prozessbegleitung. In dieser Folge erklären wir, warum es dieses besondere Unterstützungsangebot gibt und wie es Betroffene konkret durch den Prozess begleitet.
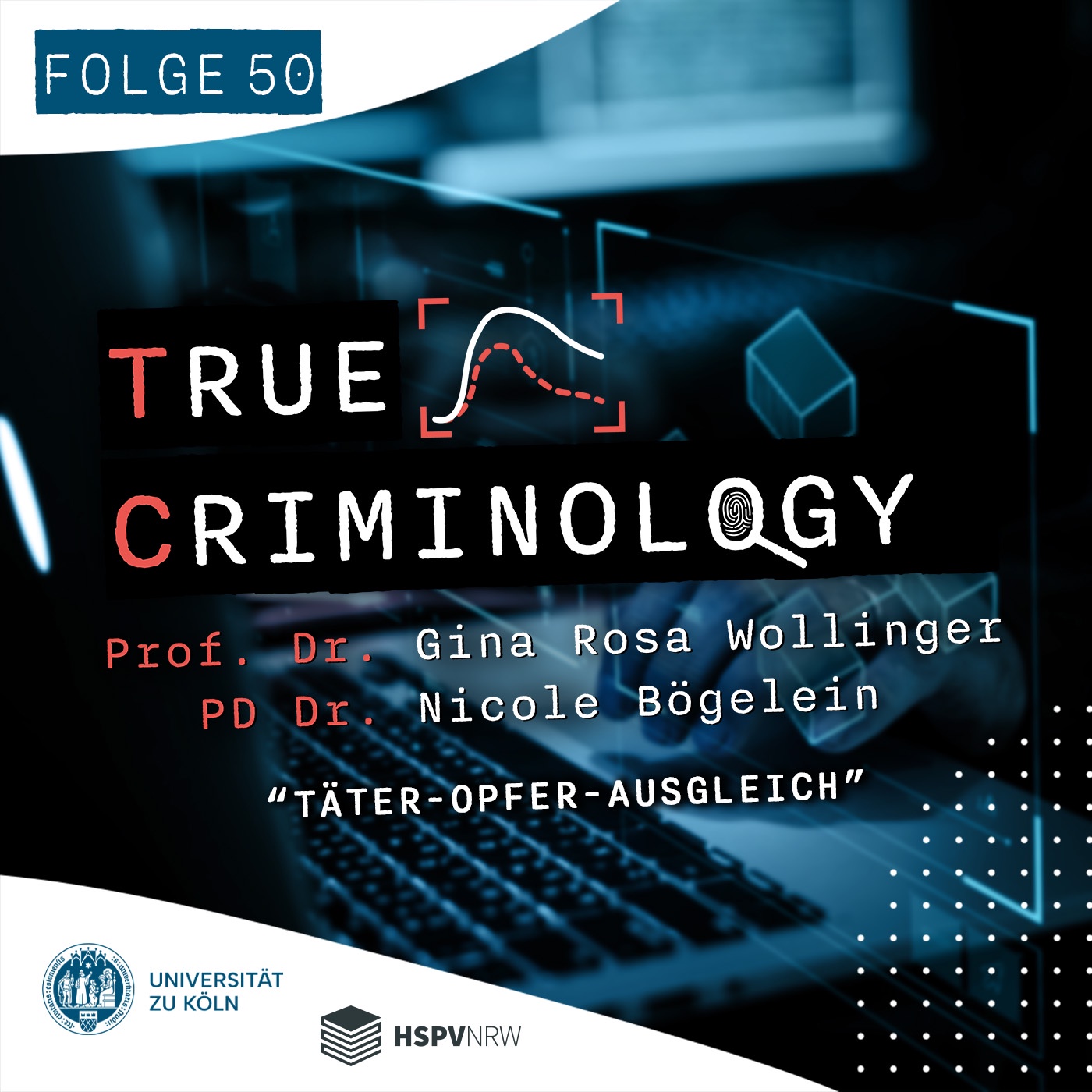
Täter-Opfer-Ausgleich
Seit vielen Jahren bietet der Täter-Opfer-Ausgleich die Möglichkeit, dass sich Täter:in und Opfer in einem geschützten Rahmen begegnen, begleitet von einer neutralen Moderation. Gemeinsam sprechen sie über das Geschehene und die Folgen der Tat. Warum dieses Modell für beide Seiten wertvoll sein kann, beleuchten wir in dieser Folge.
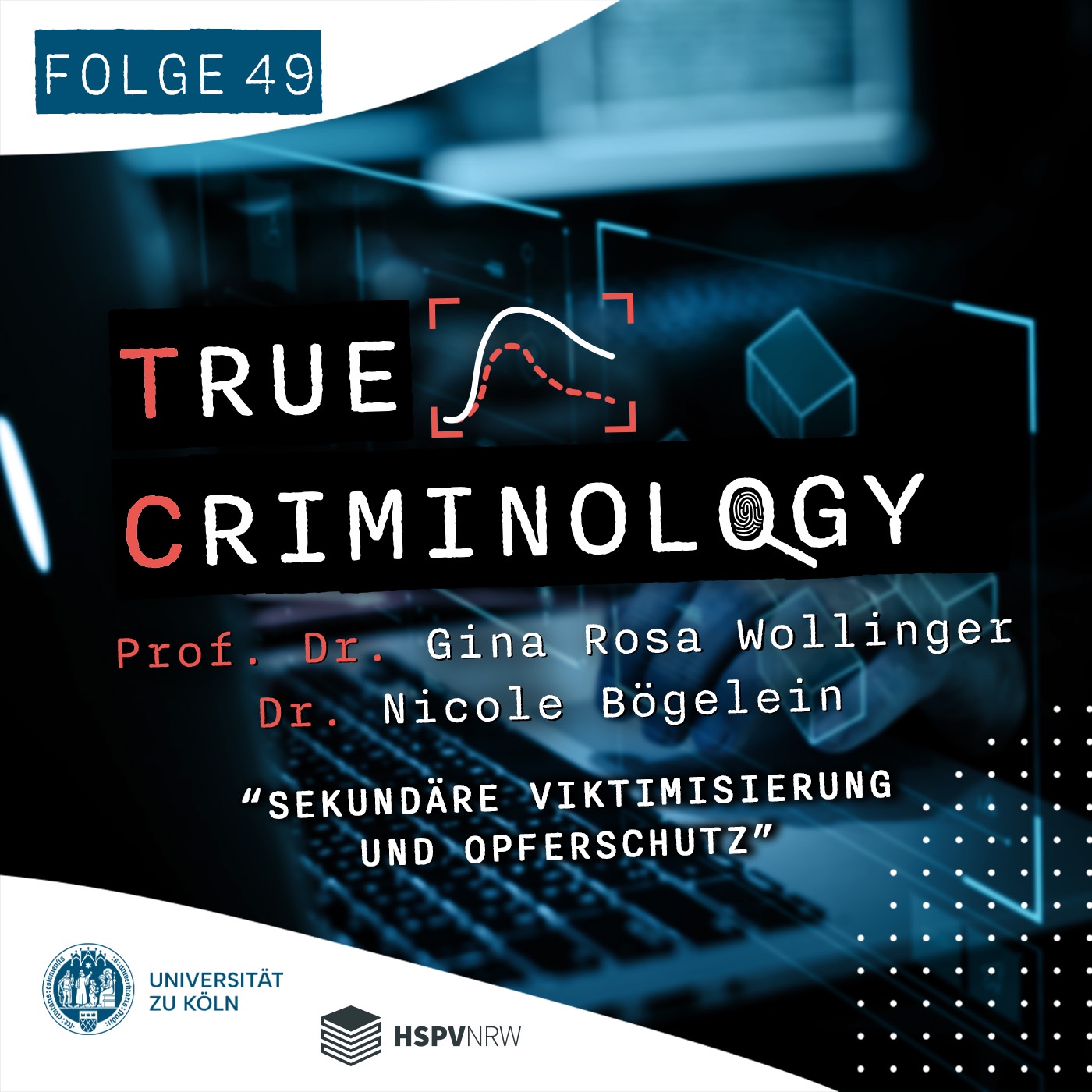
Sekundäre Viktimisierung und Opferschutz
Sekundäre Viktimisierung bezeichnet die zusätzliche psychische Belastung eines Opfers durch unangemessene Reaktionen von Institutionen wie der Polizei oder dem sozialen Umfeld nach der eigentlichen Straftat. In dieser Folge gehen wir näher darauf ein, was von Betroffenen als belastend nach einer Tat erlebt wird und wie häufig das in Bezug auf Sexualdelikte vorkommt. Ferner geben wir einen Überblick über den Opferschutz in Deutschland.
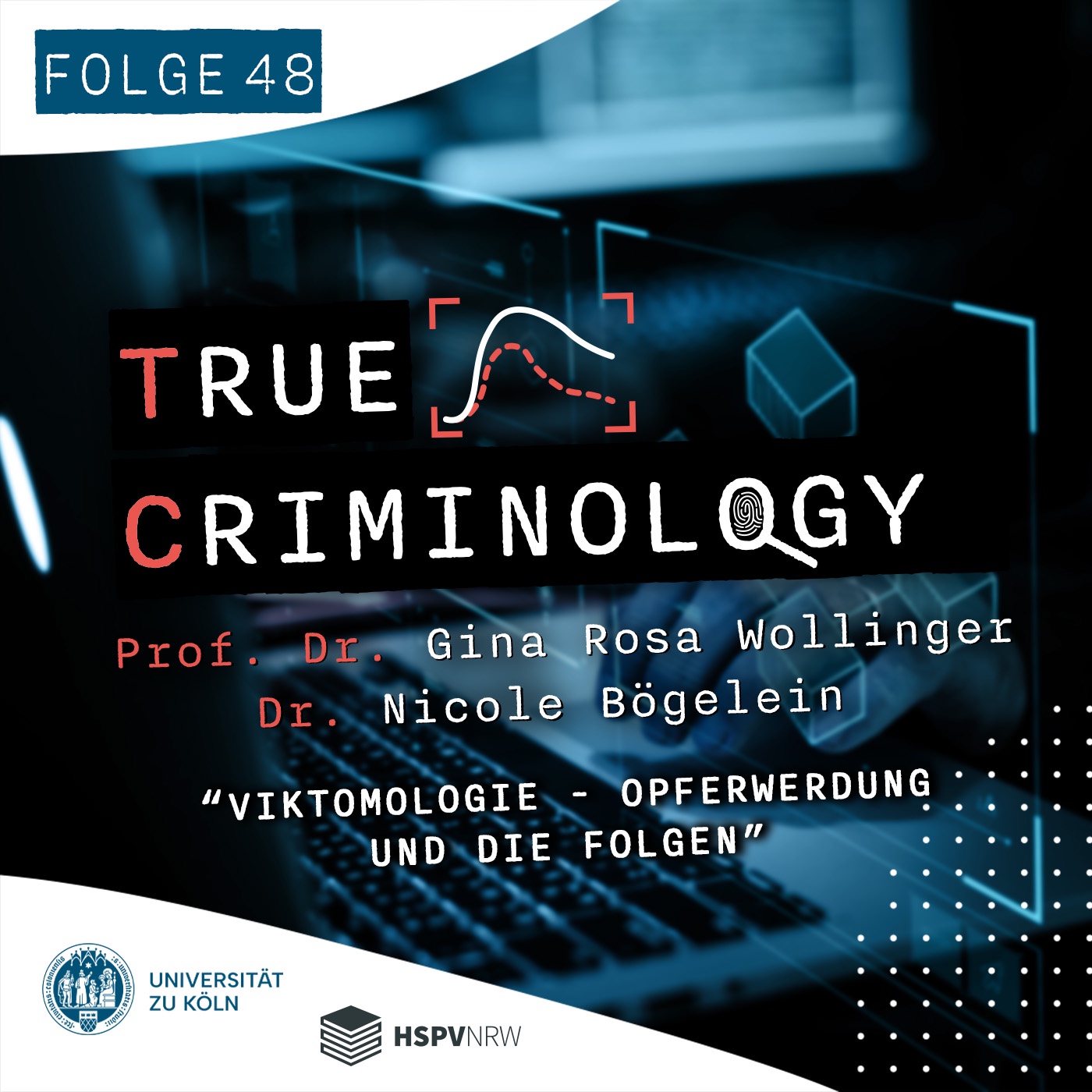
Viktimologie – Opferwerdung und die Folgen
Bisher ging es in diesem Podcast viel um spezifische Delikte und die Tatmotive. Nun beschäftigen wir uns mit der Opferperspektive.
1/6
Nächste Seite >